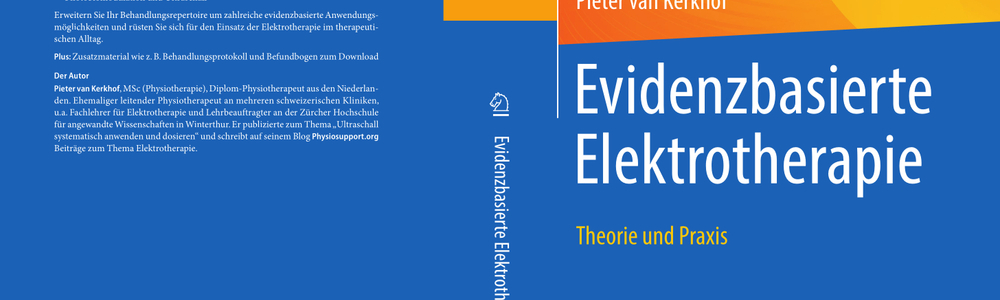Abbildungen und Referenzen finden sich im Buch.
Die zweite Auflage ist erschienen und kann hier heruntergeladen werden.
Der nachfolgende Text ist ein kleiner Teil des ausführlichen Kapitels über Schmerz und Schmerzhemmung im Buch.
Die Gate-Control-Theorie (GCT), welche die Schmerzforschung bis heute prägt, wurde im Jahre 1965 von Ronald Melzack und Patrick Wall formuliert (Abb. 2.2). Die Theorie akzeptiert die Erkenntnisse der Spezifitätstheorie und der Mustertheorie und schlägt ein Modell vor, das die scheinbaren Widersprüche dieser Theorien erklärt.
Die GCT besagt, dass die Übertragung von Schmerz vom peripheren Nerv an das Rückenmark einer Modulation durch sowohl Neuronen im Rückenmark als auch vom Gehirn unterliegt. Nicht mehr und nicht weniger. Und das macht die Eleganz dieser Theorie aus (Melzack und Wall 1965; Dickenson 2002; McMahon et al. 2013; Mendell 2014; Moayedi und Davis 2013).
Etwas konkreter formuliert, behaupteten die beiden Untersucher zunächst, dass es eine modulierende Kontrolle bei der ersten synaptischen Verbindung zwischen primären Afferenzen und Übertragungs-(T-)Zellen in Lamina II der Substantia Gelatinosa (SG) des spinalen Hinterhorns gibt.
Die Theorie umfasst im Wesentlichen drei Aspekte:
1. Wenn die neurale Aktivität von myelinisierten, schnellleitenden nicht-nozizeptiven afferenten Fasern überwiegt, hemmt es die Aktivität der dünnen, langsam leitenden nozizeptiv-afferenten Fasern über die Aktivierung von inhibitorischen Interneuronen in der Substantia Gelatinosa. Dies führt zu einer Hypoalgesie oder Analgesie.
2. Wenn die Aktivität, die durch langsam leitende, nozizeptiv-afferente Fasern vermittelt wird, überwiegt, verschlimmert es den Schmerz durch die Deaktivierung der inhibierenden SG-Interneuronen.
3. Dieser Prozess – oder das „Gating“ – wird dynamisch moduliert durch segmentale oder deszendierende zentrale Steuerung.
Melzack und Casey haben 1968 zur Verfeinerung der GCT eine multidimensionale komplexe Beschreibung von Schmerz formuliert mit drei Komponenten, die sich gegenseitig beeinflussen. Die angepasste Theorie geht davon aus, dass die körperlichen und seelischen Prozesse bei der Schmerzempfindung als Einheit verstanden werden müssen. Diese Einheit bedingt das Schmerzerleben.
• Sensorisch-diskriminative Komponente: Wir können den Schmerz nach Lokalisation, Intensität, Qualität und Dauer beschreiben. Diese Verarbeitung findet in den thalamokortikalen Strukturen statt.
• Affektiv-motivierende Komponente: Ein kaltes Bad an einem heissen Sommertag löst eine ganz andere Empfindung aus als das gleiche Bad mitten im Winter, wenn die Heizung ausgefallen ist. Zumindest in Nord- und Mitteleuropa. Eine Sinnesempfindung kann also je nach Situation lust- oder unlustbetonte Gefühle hervorrufen. Dies gilt genauso für Empfindungen mit dem Ohr, mit den Augen oder mit der Nase. Speziell ist aber, dass Schmerzen (fast) immer unser Wohlbefinden stören und die anderen Empfindungen neutral bleiben können. Die Verarbeitung findet im limbischen System statt.
• Kognitive-evaluierende Komponente: Wir können Schmerzen je nach Kontext als mild, unangenehm, beunruhigend oder unerträglich u. v. m. empfinden. Bei der Schmerzbewertung vergleichen wir die aktuellen Schmerzen mit Schmerzen aus der Vergangenheit und den dabei gemachten Erfahrungen. Es gibt viele Beweise dafür, dass Schmerz dabei durch diese zentralnervös-kognitiven Vorgänge beeinflusst wird. Dazu zählen zum Beispiel Angst, Aufmerksamkeit, Antizipation, Suggestion, Plazebos, Nozebos, kultureller Hintergrund, frühere Erfahrungen, Erziehung und Konditionierung. Diese Vorgänge können sowohl sensorische als auch affektive Reaktionen modulieren. Eine Person unter Hypnose fühlt einen eventuellen Schmerz, aber der Schmerz stört ihn weniger. Das bedeutet, dass durch Veränderung des kognitiven Zustands durch die Hypnose die affektive Komponente geändert wurde, die sensorische Komponente aber nicht.
Diese drei Komponenten interagieren und beeinflussen das motorische System, welches dann zu einer entsprechenden motorischen Reaktion auf den Stimulus führt. Verbrennt sich jemand zum Beispiel fast an einem brennenden Streichholz, so sieht die Reaktion ganz anders aus, als wenn diese Person eine unerwartet heiße, aber sehr kostbare Teetasse aus der Ming Dynastie aufhebt.
Periphere Schmerzwahrnehmung und segmentale Umschaltung
Außer den oben erwähnten drei Komponenten gibt es zwei weitere Funktionssysteme, welche an der Nozizeption beteiligt sind: der periphere Schmerzapparat und der segmentale Schmerzapparat im Rückenmark. In der Peripherie werden nozizeptive Reize von speziellen Rezeptoren in Haut, Muskeln, Knochen, Gelenken und in den inneren Organen aufgenommen. In der Haut können drei Gruppen unterschieden werden:
• Hochschwellige Mechanorezeptoren, die ihre Impulse über Aδ-Fasern zum Rückenmark leiten
• Hochschwellige Thermorezeptoren, die ihre Impulse über C-Fasern leiten
• Polymodale Rezeptoren, die ihre Impulse ebenso über C-Fasern zum Rückenmark leiten
Auf der Ebene des Rückenmarks, an den Hinterhornneuronen, kommt es zur Konvergenz von zwei Fasersystemen (Handwerker et al. 1975; Todd 2010):
• Dicke (5–12 mm), myelinisierte, rasch (30–70 m/s) leitende Nervenfasern vom Typ Aβ, die von Mechanorezeptoren (z. B. Vater-Pacini-Körperchen) ausgehen und Druck-, Berührungs-, Vibrations-Empfindungen zu den Hinterhornneuronen (Transmitter- oder T-Zellen = Interneuronen) in Lamina II und III leiten.
Manche Autoren bevorzugen eine numerische Einteilung. Hier entsprechen der Fasertyp Aβ (nach Erlanger und Gasser) dem numerischen Typ II, Aδ entspricht Typ III und die C-Fasern entsprechen Typ IV (nach Lloyd-Hunt).
• Etwas langsamer (12–30 m/s) leitende Nervenfasern vom Typ Aδ. Es handelt sich hier um dünnere (2–5 mm) Fasern mit einer dünnen Myelinschicht. Diese Fasern leiten Impulse von Nozizeptoren aus der Haut zu den T-Zellen in Lamina I und V (Schmerz, Kälte und Tastsinn): der 1. Schmerz (siehe weiter unten); und dünne (0,4–1,2 mm), langsam leitende (0,5–2 m/s) unmyelinisierte C-Fasern, welche Informationen aus den polymodalen Nozizeptoren zu Interneuronen in Lamina II (die Substantia gelatinosa) leiten: der 2. Schmerz.
In der SG erfolgt eine Umschaltung in drei Richtungen (Price 2002; Todd 2010):
• Auf den Tractus spinothalamicus, welcher die Impulse zum Thalamus leitet.
• Auf eine motorische Vorderhornzelle im gleichen Segment, von der die Impulse für Beugereflexe (Schutzreflexe) und viszero-motorische Reflexe ausgehen.
• Auf vegetative Nervenfasern im gleichen Segment, welche die vegetativen Reaktionen auf den Schmerz auslösen.
Aktivität von sowohl dicken als auch dünnen Fasern regt Interneuronen (T-Zellen) im Hinterhorn des Rückenmarks an. Impulse geleitet durch dünne Fasern hemmen inhibierende enkephalinerge Interneuronen im Hinterhorn. Dies sind die in der Lamina II und III gelegenen GABAergen Interneuronen der Substantia gelatinosa (GABA: Gamma aminobuteriyc acid). Die hemmende Wirkung dieser Interneuronen wird zum Beispiel durch Benzodiazepine wie Valium® verstärkt.
Die inhibierenden Interneuronen werden aktiviert durch Impulse, welche über die schnell leitenden Fasern geleitet werden. Diese Aktivierung der Interneuronen führt zu einer präsynaptischen Hemmung der Impulsleitung, welche letztlich zu einem „Schließen“ des spinalen „Tores“ (Gate) führt. Nebenbei: die Bezeichnung „Gate“ kommt wahrscheinlich gar nicht vom englischen „Tor“ sondern vom Schaltbild einer altmodischen Verstärkerröhre, bei der das Gitter (eben: „gate“) die Aufgabe hat, den Elektronenstrom zu modulieren.
Stimuliert man also die Aβ-Fasern, so wird durch die Einwirkung der hemmenden Interneuronen der SG der Input der langsam leitenden Schmerzfasern moduliert. Die Information, welche über die Aβ-Fasern geleitet wird, aktiviert GABAerge inhibierende Interneuronen.
Anpassung der GCT
Kritik an der Gate-Control-Theorie bezog sich auf die Tatsachen, dass die Rolle von zentralen, höheren Zentren nicht berücksichtigt wurde und dass die Theorie nicht erklärte, weshalb manchmal Schmerzen auftreten trotz Zerstörung von dünnen Nervenfasern. Deshalb schlugen in 1968 Melzack und Casey eine Anpassung der GCT vor (Melzack und Casey 1968).
Sie fügten zusätzlich die weiter oben erwähnten Systeme ein: das sensorisch-diskriminative, das motivierend-affektive und das zentrale Kontrollsystem (Abb. 2.3).
Diese zentralnervöse Modulation beeinflusst einerseits zur Schmerzäußerung die psychomotorische Komponente, wie Wehklagen und Mimik oder Verlangen nach Medikamenten, andererseits moduliert sie auch die affektive und die autonome Komponente. Beim Auftreten eines schmerzhaften Reizes treten vegetative Reaktionen auf: Die Durchblutung kann sich ändern (Vasodilatation oder Vasokonstriktion), die Herzfrequenz ändert sich, ebenso der Blutdruck und die Atemfrequenz. Die Pupillen können sich erweitern oder verengen, es kann zu verstärkter Schweißabsonderung kommen. Diese Reaktionen treten oft bei viszeralen Schmerzen (z. B. Gallenkoliken) auf und können dann noch begleitet werden von Übelkeit und Erbrechen.
Die Schmerzbewertung ist abhängig von der sozialen Situation, von dem familiären Hintergrund, von der Erziehung und von der ethnischen Herkunft. Zudem ist wichtig, unter welchen Umständen ein Schmerz auftritt. Wenn wir wissen, dass wir bei einer Blutentnahme gestochen werden, ist das Schmerzempfinden ganz anders, als wenn jemand uns unerwartet mit einer Nadel sticht. Hier wirkt die Antizipation eines Schmerzes bereits schmerzunterdrückend.
Die Gate-Control-Theorie ist nach wie vor eine allgemein akzeptierte Schmerztheorie und man hat eine Vielzahl an Rezeptoren auf Interneuronen entdeckt, die beteiligt sind an einer prä- oder postsynaptische Signalmodulation. Mehrere solche Rezeptoren, oder Kanäle, haben sich als effektive Ziele für Schmerzmedikamente entpuppt, wie zum Beispiel das Gabapentin, ein Mittel, das bei neuropathischen Schmerzen eingesetzt wird. Gabapentin bindet an einer speziellen Ca-Kanal-Untergruppe, welche aktiver wird nachdem andauernde ektopische Aktivität von geschädigten peripheren Nerven die neurale Aktivität im Rückenmark verstärkt hat.
Diese Ca-Kanäle produzieren unter anderem Glutamat, ein wichtiger Neurotransmitter in A- und C-Fasern. Diese lokale Zunahme an Glutamat führt zur verstärkten Reizung von Glutamatrezeptoren wie dem NMDA- (N-Methyl-D-Aspartat) Rezeptor, der eine wichtige Rolle spielt bei der zentralen Sensibilisierung. Letztere bewirkt eine erhöhte Erregbarkeit von spinalen Neuronen, wodurch dessen rezeptives Feld vergrößert wird und so wahrscheinlich eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer sekundären Hyperalgesie oder einer Allodynie spielt. Da der NMDA-Rezeptor unter anderem Andockstellen für Ketamine besitzt, erklärt dies die Wirksamkeit dieses Medikamentes bei gewissen Schmerzzuständen (Dickenson 2002; McMahon et al. 2013).
So gibt es viele Untergruppen von Rezeptoren auf verschiedenen Interneuronen, die je nach Kodierung der neuralen Aktivität komplexe Prozesse auslösen (Todd 2010).
Es ist klar, dass das einfache Schema, das Melzack, Wall und Casey vorgeschlagen haben, nie der Wirklichkeit entsprechen konnte, da man zu der Zeit noch nicht über die Mittel und Möglichkeiten verfügte, wie man sie heute in den modernen Labors hat. Dies macht die Theorie nur eleganter und prägnanter.